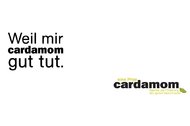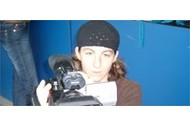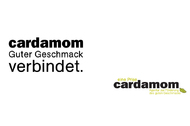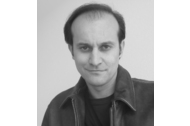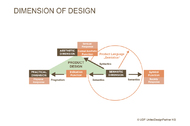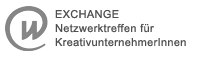|
11.07.2006
|
|
CREATIVE INDUSTRIES IN WIEN |
|
Dynamik, Arbeitsplätze und Akteure der CI in Wien |
Creative Industries als „Beschäftigungsmotor“?
- Die Wiener Kreativwirtschaft sichert im Jahr 2003 rund 107.000 Arbeitsplätze, davon bieten 93.900 voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.
- Leider sind diese aber nur bedingt nachhaltig. Kaum ¾ der neu geschaffenen Arbeitsplätze überleben das 1 Jahr.
- Die CI ist vergleichsweise dynamisch und trägt erheblich zur Verminderung von Arbeitsmarktproblemen bei.
- Für die CI entsteht das Bild eines für den Wiener Arbeitsmarkt wichtigen Wirtschaftsbereiches, der eine wesentliche Funktion als „Unternehmens- und Jobinkubator“ in der Wiener Stadtwirtschaft ausübt.
- Durch die Positionierung Wiens als Standort von regionalen Headquaters für Osteuropa wurden hier in den neunziger Jahren einige Erfolge erzielt. In einer erweiterten Union wäre diese Strategie durch das Bemühen zu ergänzen, Wien stärker als europäisches Forschungszentrum in Zentraleuropa zu positionieren.
- Es ist damit unabdingbar, die Umsetzungsschwäche in den Wiener CI stärker in den Mittelpunkt wirtschaftspolitischer Strategien zu rücken. Konkretes Ziel sollte es sein, einer weiteren Ausdünnung der regionalen CI-Wertschöpfungskette in der Reproduction durch die stärkere Vernetzung von content- und anwendungsorientierten Aktivitäten entgegen zu wirken.
- Die zunehmende funktionale Arbeitsteilung zwischen Kernstadt (als optimalem Standort für hochtechnologische und humankapitalintensive Teilfertigungen) und dem weiteren Umland mit seinen Vorteilen in Bodenverfügbarkeit und (in seinem östlichen Teil) Lohnkosten wird sich ohne Zweifel auch in Zukunft fortsetzen.
- Ein Cluster Creative Industries, der auf die Vorteile der Stadt Wien in den künstlerisch-kreativen und distributiven Teilen der Wertschöpfungskette aufbaut, in seinen reproduzierenden Teilbereichen auf die Standortvorteile der größeren CENTROPE – Region nutzt, hätte wohl die besten Chancen, mittelfristig auch auf europäischer Ebene Wettbewerbsvorteile zu akkumulieren.
Welche Jobs bieten die „Creative Industries“?
- Im Wesentlichen bleiben die Wiener Creative Industries damit ein Wirtschaftsbereich, der vor allem jungen Erwerbstätigen mit hoher formaler Qualifikation und spezifischen Arbeitsinteressen und Rollenmodellen neue Arbeitsplätze bietet.
- Mechanismen der Atypisierung und Flexibilisierung sind in der unselbständigen Beschäftigung der Wiener CI ebenso sichtbar wie zunehmende Jobinstabilität und eine Spreizung der Einkommensverteilung.
- Trotz dieser rasanten Atypisierung – immerhin waren seit Mitter der geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Werkverträge und freie Dienstverträge zurückzuführen – bleiben Standardbeschäftigungsverhältnisse mit einem Anteil von rund 88 % zumindest unter den Unselbständigen des Clusters dominierende Arbeitsform.
- Im mehrjährigen Schnitt werden in den Wiener CI pro Jahr 8!) rund 70 % aller Beschäftigungsverhältnisse neu aufgenommen und eine kaum niedrigere Zahl wieder beendet – ein enormer Beschäftigungsumschlag, der um rund ein Fünftel höher liegt als in der Wiener Wirtschaft insgesamt.
- Die Einkommen der unselbständigen Standardbeschäftigten in den Wiener CI liegen zuletzt um 13 % höher als im Durchschnitt der Wiener Branchen, was bei vergleichsweise hohem Qualifikationsniveau eine spürbare „Skill-Prämie“ repräsentiert.
- Junge Beschäftigte und Frauen sind in den atypischen Beschäftigungsverhältnissen der Wiener CI deutlich überrepräsentiert, und auch in der Kernbelegschaft sind Frauen mit kürzeren Beschäftigungsdauern und geringeren Einkommen konfrontiert. Zuletzt erreichen die Fraueneinkommen in den Wiener CI nur rund zwei Drittel des Niveaus der Männer.
- CI-Betriebe rekrutieren seltener aus der Arbeitslosigkeit, was nicht zuletzt mit den spezifischen Humankapitalanforderungen im Cluster in Zusammenhang stehen dürfte.
Artist-Entrepreneurship in der österreichischen Musikindustrie
- Die künstlerische Eben der Musikindustrie ist von einer hohen intrinsischen Motivation der Akteure geprägt und somit relativ unabhängig von finanziellen Anreizen. Andererseits wird deutlich, dass es zu einem Mangel an Investition in die Erschließung des kreativen Potenzials kommen würde. Der unternehmerische Anteil an der Bereitstellung musikalischer Werke erwirtschaftet den Großteil der Gesamtwertschöpfung in der Musikindustrie.
- Durch die Vertriebsmöglichkeiten über das Internet sinken die Zugangskosten für weltweite Distributionsnetzwerke. Die Majors verloren das Vertriebsmonopol im Bereich des digitalen Musikvertriebs, was den Zugang zu den Distributionsnetzwerken für unabhängige Künstler zusätzlich erleichtert.
- Durch Social-Networking-Communities entstehen Vorteile von Anbieter von Nischenmusiken, die günstig und sehr ziegerichtet beworben werden können.
- Auf dem Wege des Artist-Entrepreneurships (Künstler selbst nutzen neue Technologien um zu produzieren, vervielfältigen, vertreiben und bewerben) gelangen künstlerische Werke in großen Mengen ungefiltert und in oft ungeschliffener Form auf den Markt. Gatekeeper und damit die Hürden des Marktzugangs können somit umgangen werden.
- Die traditionelle Arbeitsweise für Künstler in der Musikindustrie in Form eines Vertragsverhältnisses mit einer Plattenfirma ist aus finanzieller Sicht nach wie vor die lukrativere. Erste Beispiele, bei denen Künstler ohne Plattenvertrag in die Charts einsteigen und bekanntes Superstars aus den Hitparaden drängen, zeigen aber das Potenzial, das in den neuen Vermarktungsmöglichkeiten steckt.
- Die von den Autoren Friebe und Lobo als so genannte digitale Boheme bezeichnet neue Gruppe von Kreativen, die abseits der normalen Angestelltenverhältnisse und Industriestrukturen die neuen Potenziale, die das Internet und die Digitalisierung bieten, nutzt, stellt kreative Güter in Form von Filmen, Blogs, Podcasts, Bildern, und Musik in großem Ausmaß her und stellt für etablierte Inhalteproduzenten einen zunehmende Bedrohung dar. In diesem Sinne können die neuen Entwicklungen als eine Gegenbewegung zu den Massenmedien in Form einer Demokratisierung der Kunstproduktion verstanden werden.
die wichtigsten Ergebnisse sind unter: http://www.forba.at/kreativbranchen-wien/ abrufbar und sonst im Fachhandel bestellbar